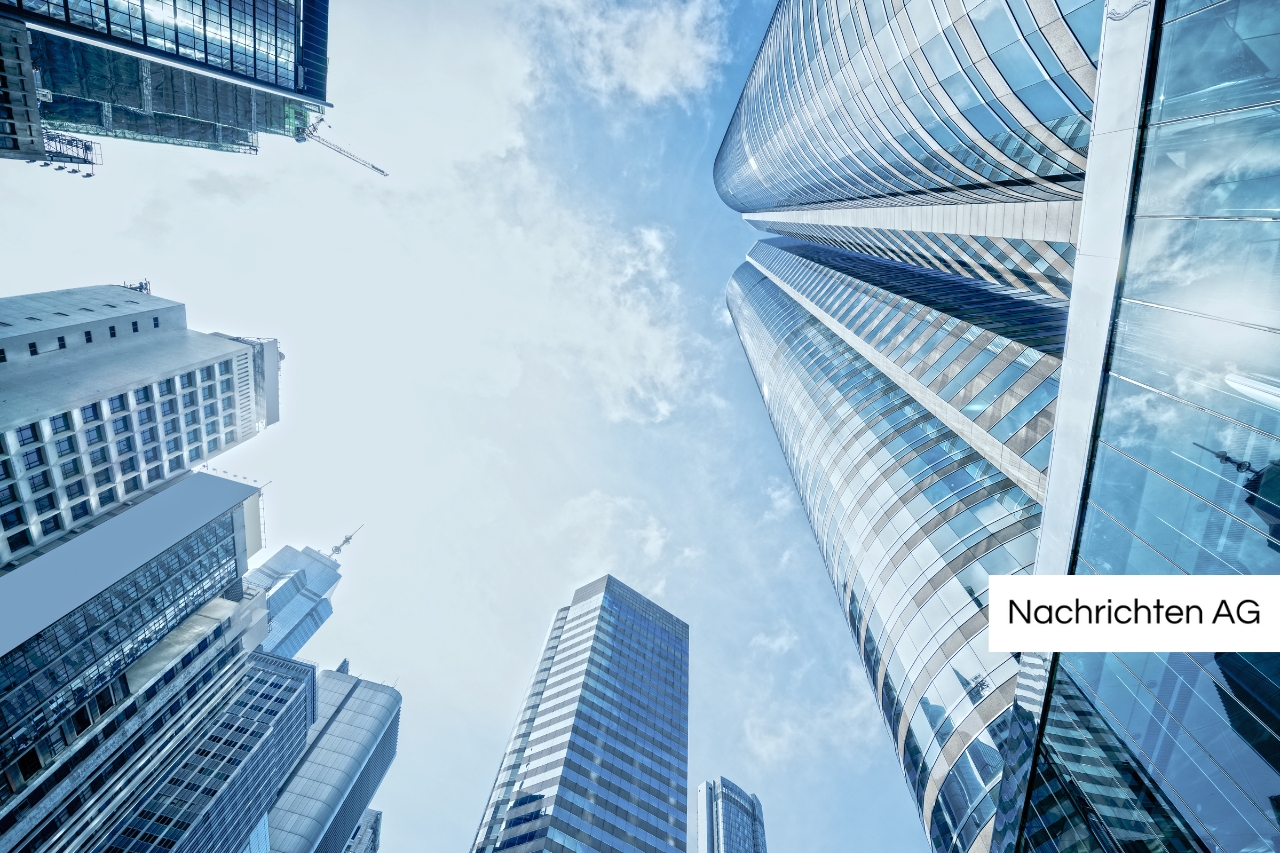
In der Diskussion um den Maschinenbau in Deutschland in der Nachkriegszeit wird oft auf die Exporte aus der DDR in die Jahre von 1970 bis 1990 verwiesen. Diese Exporte umfassten vor allem Werkzeugmaschinen, die in den Ostblock, Iran, Irak, England, Spanien, Afrika sowie Südafrika verkauft wurden. Über Strohfirmen gelang es vielen Betrieben, westliche Steuerungen zu beschaffen, um die Zieladresse geheim zu halten. Ein Beispiel für die Preisunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind die Esda-Damenstrümpfe, die in der DDR rund 9,90 Ostmark kosteten, während sie in einer Wühlkiste in Westdeutschland lediglich 0,50 DM kosteten.
Berichten zufolge gab es die Behauptung, dass der Westen den Handel mit der DDR sabotiert habe, um wirtschaftliche Gewinne zu verhindern. In diesem Kontext wird auch der Wiederaufbau der Barock-Kirche in Dresden diskutiert, sowie die Möglichkeit, den Maschinenbau in Deutschland wieder aufleben zu lassen. Kritiker äußern sich zudem zur Rolle der Treuhand und zum mangelnden Interesse der westdeutschen Wirtschaft am Maschinenbau. Es wird eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik gefordert, da klare Themen für die Schaffung neuer Industrieparks notwendig seien. Darüber hinaus wird auf die Monokultur in der Energieversorgung hingewiesen und deren damit verbundene Abhängigkeiten. In diesem Zusammenhang wurden auch Probleme bei den Projekten „Intel“ und „NORD-VOLT“ im Norden Deutschlands erwähnt, wie MDR.de berichtet.
Produktivität und wirtschaftliche Herausforderungen der DDR
Im Allgemeinen war die Produktivität in der DDR von verschiedenen Faktoren abhängig, darunter die Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte und die Ausstattung mit Maschinen. Eine Aufarbeitung der wirtschaftlichen Bedingungen in der DDR zeigt, dass die planwirtschaftliche Ordnung zu einer ineffizienten Nutzung der Ressourcen führte. Die zentrale Planung und staatliche Kontrolle schränkten die Eigenverantwortung der Betriebe stark ein, was sich negativ auf die Produktivität auswirkte. Die DDR verfügte über ein niedriges Produktivitätsniveau, das durch mangelnde statistische Daten und unterschiedliche Berechnungsmethoden erschwert wurde. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung lag die Arbeitsproduktivität 1968 bei nur 68,4 % und 1983 bei 47 % des westdeutschen Niveaus.
Aktuelle Schätzungen sprechen von etwa einem Drittel der westdeutschen Produktivität. Diese Rückstände in der Produktivität wurden unter anderem auch durch die staatsmonopolistische Ordnung und die damit verbundenen Informationsmängel verstärkt. Mit der Einführung einer marktwirtschaftlichen Ordnung in der DDR wird eine Verbesserung der Produktivität als notwendig erachtet. Allerdings bringt diese Transformation auch Herausforderungen mit sich, insbesondere in Bezug auf die Privatisierung und die Preisbildung. Die Umstellung sowie die damit einhergehende Wirtschafts- und Sozialunion erfordert beitragende Betriebe und Managementkompetenz, wie bpb.de hervorhebt.



