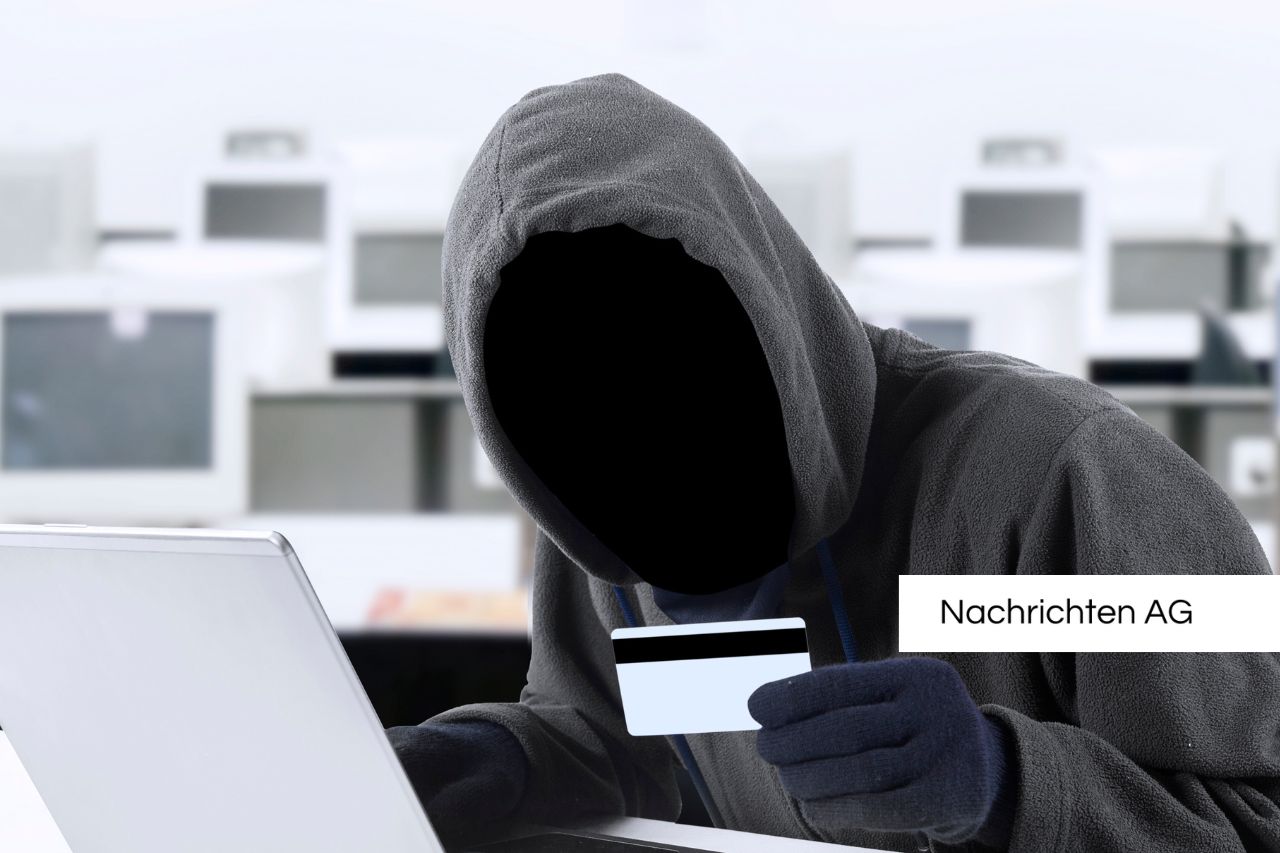
Der Landkreistag hat die anhaltenden finanziellen Engpässe in der Kinderbetreuung thematisiert und berichtet von jährlichen Millionenlöchern in den Etats der Landkreise seit der Reform des Kitagesetzes im Jahr 2020. Die ungedeckten Mehrkosten für die Landkreise in der Kinderbetreuung belaufen sich von 2020 bis 2023 auf rund 126 Millionen Euro. Schätzungen zufolge könnten diese Mehrkosten bis Ende 2024 bereits 150 Millionen Euro überschreiten.
Heiko Kärger, Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte und Vorsitzender des Landkreistages, hat die Landesregierung scharf kritisiert. Er bemängelt die Übertragung kostenträchtiger Aufgaben auf die Landkreise ohne eine angemessene Finanzierung. „Laut Landesverfassung müssen bei der Verpflichtung der Landkreise zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben auch Regelungen zur Kostendeckung getroffen werden“, äußerte Kärger. Dennoch dauern die Verhandlungen mit dem Land lange, weshalb ein Teil der Mehrkosten bei den Landkreisen bleibt.
Klage vor dem Landesverfassungsgericht
Im Landkreis Vorpommern-Greifswald wurde in Zusammenarbeit mit allen Kreisen eine Beschwerde beim Landesverfassungsgericht eingelegt. Ein entsprechendes Gutachten liegt bereits vor, und die Verantwortlichen hoffen auf eine positive Entscheidung des Gerichts. Interessant dabei ist, dass Mecklenburg-Vorpommern und Berlin die einzigen Bundesländer sind, in denen der Kita-Besuch für Eltern kostenfrei ist. Im vergangenen Jahr haben Land und Kommunen insgesamt 923 Millionen Euro für die Kindertagesförderung bereitgestellt.
Der Anteil des Landes an dieser Finanzierung betrug 503 Millionen Euro (54,5 %), während die Kommunen 420 Millionen Euro investierten. Es ist außerdem zu verzeichnen, dass die Kosten für die Kita-Förderung stetig steigen: Im Jahr 2023 belief sich die staatliche Kita-Förderung auf 872 Millionen Euro, während es im Vorjahr noch 797 Millionen Euro waren.
Das Thema der kommunalen Finanzen ist nicht neu. So hat das Urteil des Landesverfassungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 20. Oktober 2015 in der Vergangenheit bereits für Aufsehen gesorgt. Die Auslegung von Art. 87 der Verfassung führte zur Erfolglosigkeit kommunaler Verfassungsbeschwerden, da die Beschwerdeführerinnen nicht davon ausgehen konnten, dass kein gleichwertiger Schutz der kommunalen Selbstverwaltung gewährleistet wird. Diese Auslegung wich darüber hinaus von der bisherigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und anderen Landesverfassungsgerichten ab, was Fragen zur Verlässlichkeit solcher Urteile aufwirft, wie es [bundesverfassungsgericht.de](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2017/11/rs20171121_2bvr217716.html) darstellt.



