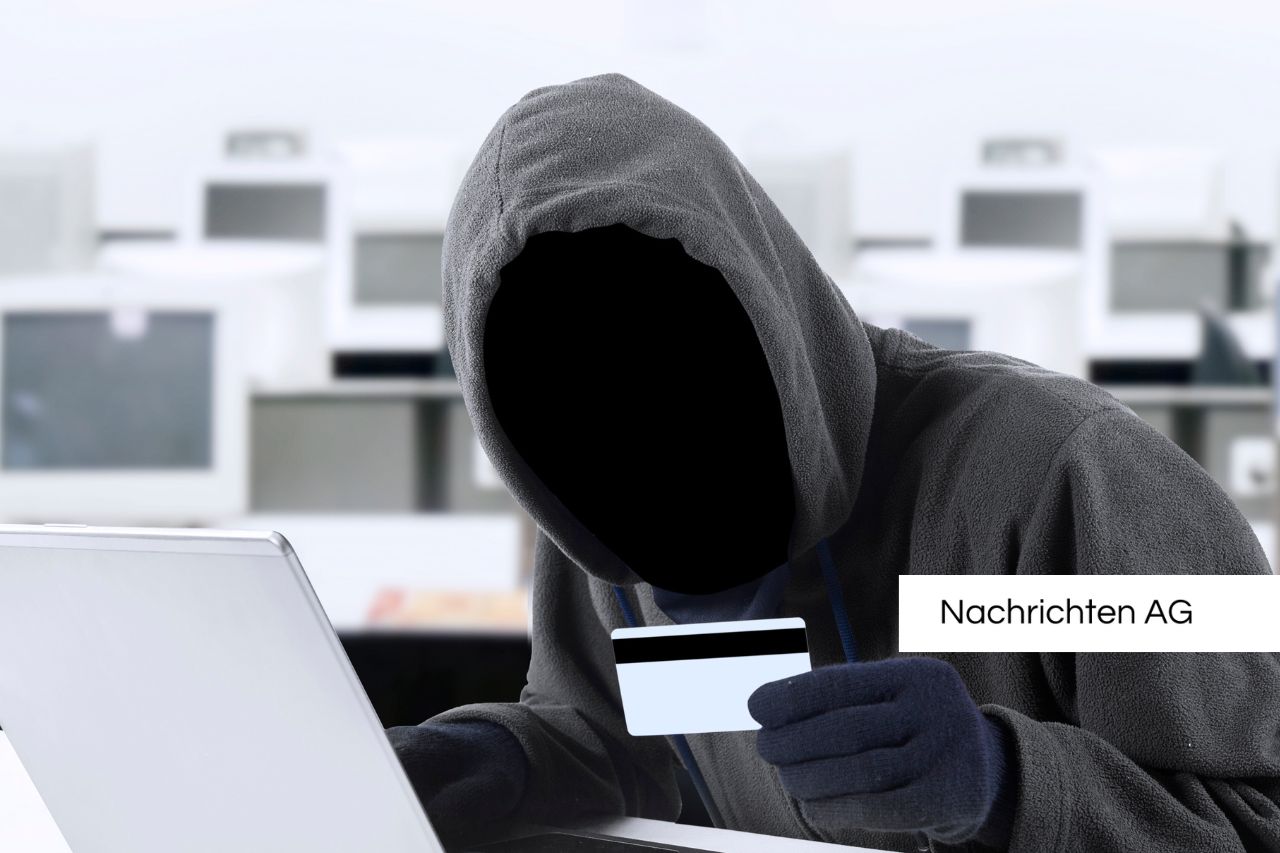
Im Nationalpark Berchtesgaden ist der Zustand des Blaueisgletschers besorgniserregend. Die Politikerinnen Gisela Sengl und Katharina Schulze machten sich vor Ort ein Bild von der Situation des Gletschers, der laut Prognosen bis 2030 verschwunden sein könnte, wenn die derzeitigen Entwicklungen anhalten. Diese Informationen wurden von rosenheim24.de berichtet.
Der Rückgang des Blaueisgletschers hat lokale Auswirkungen auf das Klima und die Wasserversorgung der Blaueishütte. Gisela Sengl äußerte Besorgnis über das rasche Schmelzen des Gletschers, der nicht ausreichend Schnee erhält, um sich zu regenerieren. Seit den 1980er Jahren sind Felsen sichtbar geworden, die den Gletscher vom unteren Toteis-Feld trennen. Im Jahr 2009 misst man die Fläche der beiden Eisfelder zusammen lediglich 7,5 Hektar. Während die Eisdicke 2007 bis zu 13 Meter betrug, liegt die mittlere Eisdicke heute bei weniger als 4 Metern. Dies hat auch Auswirkungen auf die Tierwelt, da Tiere im Nationalpark auf kühlere Nordhänge ausweichen müssen. Der Schneehase und der Gletscherfloh gelten mittlerweile als vom Aussterben bedroht.
Folgen der Gletscherschmelze
Die Gletschermasse in Deutschland könnte theoretisch innerhalb von 17 Stunden über die Isar nach München fließen, was als Warnsignal für globale Entwicklungen angesehen wird. Katharina Schulze kritisierte den neuen Koalitionsvertrag der deutschen Regierung aufgrund mangelnder Klimaschutzmaßnahmen und hob hervor, dass die frühzeitige Schneeschmelze zu Problemen führt. Wenig Niederschlag könnte trockenen Boden verursachen und somit im Frühling Hochwasser sowie im Sommer Dürre zur Folge haben. Schulze betonte die Notwendigkeit, die Auswirkungen des Klimawandels und das Gletschersterben vermehrt in der Öffentlichkeit zur Sprache zu bringen. Zudem sieht sie Falschinformationen zum Klimawandel als ein Hindernis für notwendige Klimaschutzmaßnahmen und fordert mehr Bildung sowie stärkere Sicherheitsbehörden zur Bekämpfung von Desinformation.
Generell steht die Gletscherschmelze weltweit im Mittelpunkt der Klimaforschung. Wie deutschlandfunk.de berichtet, sind mehr als 275.000 Gletscher durch den Klimawandel gefährdet. Diese Gletscher haben nicht nur Einfluss auf den Anstieg des Meeresspiegels, sondern auch auf die Wasserversorgung, Ökosysteme und die Klimaforschung. Es wird geschätzt, dass seit 2000 jährlich rund 273 Milliarden Tonnen Eis verloren gingen und der Verlust zwischen 2022 und 2024 besonders stark war.
Regionen wie die Anden, der Himalaya und die Alpen sind besonders betroffen, wobei bis zu 50% der Gletschermasse dort bis zum Ende des Jahrhunderts verloren gehen könnte. Auch wenn der Gletscherrückgang in einigen Gebieten wie der kanadischen Arktis weniger stark ausgeprägt ist, könnten viele Gletscher in Kanada, den USA, Skandinavien und Neuseeland nicht überleben. Der Durchschnittliche Massenverlust der Gletscher im Jahr 2023/24 beträgt rund 1,4 Meter, was auch zu einem Anstieg des Meeresspiegels um etwa 18 Millimeter beiträgt und in Küstenregionen zusätzliche Überschwemmungsgefahr mit sich bringt.



